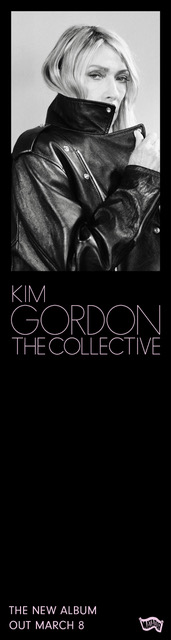Bis zur Grenze der Selbstaufhebung
In einem Jahr ist Bundestagswahl. Das politische Koordinatensystem ist jetzt schon zerbröselt, ganz gleich, ob es für Merkels vierte Amtsperiode doch noch reicht oder Sigmar Gabriel die SPD tapfer über zwanzig Prozent hält. Wer die Gründe fürs Zerbröseln sucht, darf nicht da suchen, wo sich lautstark darüber beklagt wird – im Politikbetrieb. In einer Serie, die monatlich bis zur Bundestagswahl fortgeführt wird, analysiert Felix Klopotek die »Politik der Mitte«, in der sich Aufstieg und Niedergang der politischen Moral exemplarisch verdichten.
Bis zur Grenze der Selbstaufhebung
Anlässlich des Streitgesprächs zwischen Sahra Wagenknecht und Frauke Petry
Warum fällt den Linken so wenig gegen den Durchmarsch (der in Wirklichkeit keiner ist) der Rechtspopulisten genannten Postfaschisten ein? Das ist ja ein europäisches Problem. Besonders der Totalzerfall der französischen und italienischen Linken bereitet Sorgen. Als nächste wäre wohl die hiesige Linkspartei an der Reihe.
Zwei Erklärungsansätze kursieren. Es sieht aus, als stünden sie im Widerspruch zueinander, aber sie beziehen sich auf verschiedene Ebenen des Problems. Die Schlüsse, die aus ihnen von vielen Linken gezogen werden, berühren in ihrer Vergeblichkeit vielleicht das eigentliche Problem. Aber der Reihe nach.
Die erste Erklärung lautet etwa so: Zwischen Anhängern, Wählern, ja sogar Mitgliedern und Aktivisten der Linken und der Rechten und Ganzrechten besteht kein großer Unterschied: Sozialneid (»uns wird was weggenommen«), das Gefühl der Benachteiligung und des Zukurzkommens, Ressentiments gegen »das Fremde« sowie Hass auf Feminismus finden sich auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Da die AfD und die mit ihr assoziierte Pegida-Bewegung institutionell (noch) nicht eingebunden sind, während die Linke unbedingt eingebunden sein will und also auf künftige Regierungsämter schielt, erscheinen sie dort als unverfälschter, kompromissloser, authentischer. Der Switch, den viele Linkswähler nach rechts machen, wäre demnach keine Frage des Verrats oder der Verirrung, sondern eine des Stils. Der Kern ihrer Überzeugung hätte sich kaum gewandelt.
Die zweite Erklärung: Die Aktivistinnen und Aktivisten der Linken haben sich nach »1968« und spätestens mit dem Aufkommen der Grünen in Identitäts- und Lifestyle-Politik verstrickt. Die proletarische Revolution ist gescheitert, der kleinbürgerliche Sozialstaat ist gekommen: Das war die Bilanz nach dreißig Jahren Weltbürgerkrieg (1914-1945) und dreißig Jahren Nachkriegsboom (1945-1975). Nicht zuletzt waren es die linken Eliten, die vom Nachkriegsboom und der Ausdehnung des Sozialstaats profitierten. Die »soziale Frage« war für sie erledigt, es begann die Zeit der partikularen Forderungen, der Bürgerinitiativen, der Sprachpolitik, der Verherrlichung der (eigenen) Nische. Zwischenzeitliche ökonomische Krisen – auf Seiten der Linken immer mit einer hektischen Wiederaufnahme der Marx-Lektüre als eigentümliche Form der Verarbeitung verbunden – ändern nichts an der grundsätzlichen Entfremdung der Linken (ob es nun beamtete Gleichstellungsbeauftragte oder rotzige Hausbesetzer sind) gegenüber Arbeitern, Armen, Prekarisierten.
Die hiesige Linkspartei war – und ist es vielleicht immer noch – die personifizierte Verlaufsform dieses Widerspruchs: Denn ihr Erfolg nach 2005 (die alte PDS war nach ihrer Abwahl aus dem Bundestag 2002 de facto erledigt) verdankt sich einer sozialen Bewegung von unten, nämlich der Anti-Hartz-Bewegung, die bis in die Gewerkschaften hineinwirkte. Es dauerte nur wenige Jahre, bis sich diese ursprüngliche Bewegung in der (Personal-)Struktur nicht mehr widerspiegelte. Es sind erfahrene Polit- und Bewegungsprofis sowie Vordenker aus dem akademischen Milieu, die die Partei geistig und strategisch prägen. Man kann demnach einen Widerspruch zwischen der Wählerbasis und ihrer politischen Repräsentationen konstatieren – der den Repräsentanten in diesen Wochen um die Ohren fliegt.
Zwei Schlüsse werden daraus gezogen: Den ersten scheinen besonders eifrig Frau Wagenknecht und ihr Gatte Lafontaine zu präferieren – man überholt gewissermaßen die Wählerwanderung von links nach rechts, wie im Hase-Igel-Spiel, und möchte den potentiell oder auch schon real enttäuschten Wählern zuvorkommen. Im Klartext: Man nimmt AfD-Positionen ein und behauptet, sie als Linke doch viel besser vertreten zu können. Intellektuell vornehmer nennt man diese Strategie Linkspopulismus. Nach innen besteht ihr Ertrag in einer Art Selbstkritik der Eliten: Ja, man habe sich tatsächlich den Abgehängten entfremdet und sich in einer übertrieben verfeinerten Minderheiten- und Sprachpolitik verstrickt.
Der zweite Schluss ist dem diametral entgegengesetzt: Populismus bedeute Ausverkauf und Anbiederung, deren Effekte immer darin bestünden, dass die Angesprochenen sich für das Original entscheiden würden – für die AfD. Vielmehr müsse man jetzt Standhaftigkeit beweisen, in der Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik keinen Schritt zurückweichen und zum Beispiel feministische und sexualpolitische Positionen nicht in einem betrügerischen Handel gegen etwaige Wählerstimmen eintauschen. Aktuell bedeutete das Verluste bei Wahlen, aber langfristig würde sich Standhaftigkeit auszahlen.
Es bedarf nicht viel Anstrengung, um in diesem Diskurs heillose Konfusion zu erkennen. Denn natürlich wird sich keine dieser Positionen in Reinform durchsetzen: Weder wird sich Wagenknecht vollends als Populistin outen, noch dürfte der zweite Schluss, der »gesinnungsethische«, mehrheitsfähig sein: zu viele materielle Interessen – Jobs! »Staatsknete«! – knüpfen sich in der Partei an auch zukünftig stabile Wahlergebnisse. Es existiert ein wilder Mix aus diesen Positionen – innerhalb der Partei/Bewegung und vermutlich auch innerhalb eines jeden ihrer Köpfe –, und unterm Strich kommt immer nur der Katzenjammer heraus:
Was kann die Linke denn überhaupt noch effektiv gegen rechts tun?
Wie erreichen wir die Leute?
In dieser Strategiedebatte dringt schon das Eingeständnis durch, dass der Zug abgefahren ist. Das Jammern nimmt das Ergebnis vorweg: Wir können eigentlich gar nichts mehr tun.
Wo liegt der Fehler?
Beide Erklärungsansätze und die möglichen Schlussfolgerungen daraus basieren auf einer falschen Voraussetzung. Man kann sie das »verteilungstheoretische Argument« nennen. Demnach sind Fragen von Reichtum und sozialer Sicherheit Fragen der gerechten Verteilung. Das Ressentiment – DIE, also die Flüchtlinge, die Frauen, die Hartz’ler, die Migranten …, nehmen uns was weg – will die Linke rational beantworten: »Geld ist genug da«, Umverteilung von oben nach unten, bessere Zugangsbedingungen zum Arbeitsmarkt, Quotenregelungen, dies sind die Schlagworte, die für eine bessere Verteilung des Reichtums stehen, »Verteilungsgerechtigkeit« nennt man das auch. Mit diesem Schlagwort konkurriert die Linke bereits auf dem Feld der Rechten und hat eigentlich schon verloren. Die Rechte denkt in abgeschlossenen, geronnenen, fetischisierten Formen – die Nation, das Volk, die Sprache, die Kultur. Geschichte taucht nur noch als Vorherbestimmung und Schicksal auf. Innerhalb dieser Formen sind die Austauschbeziehungen, die Frage, wem was zugesprochen wird, klar geregelt. Jedem das seine. Die Idee der Verteilungsgerechtigkeit ist tatsächlich eine rechte. Nach dieser Logik gelangt man in wenigen Schritten zu der absurden Vorstellung, dass DIE (wer immer das sein mag) UNS (wer immer das sein mag) etwas wegnähmen.
Der Reichtum dieser Gesellschaft besteht aber nicht in einer Art Kuchen, der aufgeteilt wird (und dann ist er weg), sondern in der Potenz, prinzipiell unendliche viele Kuchen herzustellen. Mit der modernen Warenproduktion ist die Überflussgesellschaft realisiert. Allerdings als eine solche, die die Klassenspaltung vertieft, Krisen nicht vermeiden kann und in ihnen Armut und Elend ohne Ende – im nationalen wie im internationalen Maßstab – hervorruft. Das impliziert keine lineare Verelendung, aber eine prinzipielle Verunsicherung und Destabilisierung unseres sozialen Lebens. An dieser Gesellschaft eine ungerechte Verteilung zu kritisieren, die es zweifelsohne gibt, greift zu kurz und blamiert sich gegenüber der rechten Rhetorik, die mit Evidenzen auftrumpft: feste Rollenzuweisungen, Grenzsicherung, also Ausgrenzung von als Schmarotzer diffamierten Menschengruppen. Natürlich muss man dagegen agitieren. Aber es ist schwierig bis unmöglich einen Erfolg zu erzielen, der sich nicht als Pyrrhussieg entpuppt, wenn man die gleichen Prämissen teilt.
Die Linke hatte nach 2005 zwei klare Forderungen, mit denen sie ihren raschen Aufstieg begründete: Weg mit Hartz 4 und überhaupt der ganzen Agenda 2010; gegen den Afghanistan-Krieg und damit auch gegen jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr. Sie hat die Forderungen nicht revidiert, aber sie bestehen nur noch auf dem Papier und sind dementsprechend weniger wert als eben jenes Papier, auf dem sie gedruckt sind. Einer Regierungsbeteiligung im nächsten Jahr würden sie geopfert. Beide Forderungen haben ein radikales Moment: dass es nicht mehr ums Rechnen und Taktieren geht, sondern um Abschaffung – Abschaffung eines repressiven Systems der Sozialalimentierung; Abschaffung des Neo-Militarismus. Für ein zukünftiges Programm der Abschaffungen kein schlechter Anfang. Es waren, um in der Metaphorik zu bleiben, keine populistischen, sondern utopische Forderungen. Die Radikalität, sprich: Grundsätzlichkeit, mit der in dieser Gesellschaft Ausbeutung betrieben und politisch verwaltet wird, ist einzig eine Radikalität der Forderungen angemessen.
Der Punkt ist freilich, dass wir mit ihnen am Ende der Linkspartei angelangt wären. Parteiförmig lässt sich diese Radikalität nämlich nicht durchhalten. Allein schon die materiellen Interessen, die mit der Partei verknüpft sind – sie ist eine Jobmaschine für große Teile der linken Intelligenz –, stünden dagegen. Schnell würde der Linken »Politikunfähigkeit« bescheinigt werden, sie würde zuerst aus der Berichterstattung und dann aus den Parlamenten verschwinden. Sie hätte alle Etablierten gegen sich, und die Rechtspopulisten sowieso. Kurz- und mittelfristig fänden die radikalen Forderungen kein Gehör, erst mit den Keimen einer neuen sozialen Bewegung der Prekarisierten hätten sie einen Adressaten. Sie eignen sich also nicht für Opportunismus und tagespolitische Taktierereien. Mit ihnen käme die Partei an die Grenze zur Selbstaufhebung. Schließlich würden sich die Forderungen selbst auflösen in einen allgemeinen Kampf um das gute Leben.
Wir sehen also, dies ist alles ganz abwegig. Es scheint unvorstellbar und praktisch sowieso undurchführbar. Aber nur solange wir uns auf den medial und politisch akzeptierten Bahnen der Auseinandersetzung mit »rechts« bewegen. Der dafür angemessene Ausdruck ist ein »Streitgespräch« zwischen Sahra Wagenknecht und Frauke Petry.