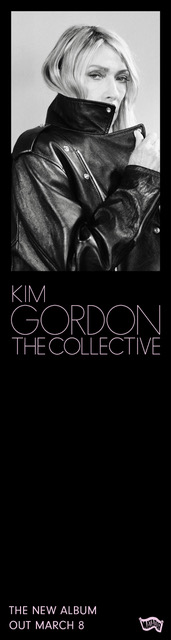Tortoise “The Catastrophist”
 Tortoise
Tortoise
“The Catastrophist”
(Thrill Jockey)
Tortoise haben mir vor Jahren ein unvergessliches, transzendentales Far-Out-Konzerterlebnis beschert: Im Dreierpack mit The Sea and Cake und Trans Am zeigte die Band aus Chicago den Kiddies und Althippies im Marburger KFZ, was eine Postrock-Harke ist – stundenlang. Großartig. Ich hab‘ mal geguckt, wann das war: 1996.
So, und bevor es wieder heißt, „oh Mann, Frau M. schwelgt wieder in ihren verklärten Erinnerungen von annodunnemals“, komme ich gleich zum Punkt und zwar: Was bedeuten Tortoise heute noch?
„The Catastrophist“ ist das erste Album seit sieben Jahren Veröffentlichungspause, was bei einer Band, die nie irgendwelche Hitlisten anführte und nur Leuten etwas bedeutet, die auf schnelle Taktung keinen Wert legen, gar nicht mal so lang ist – oder? John McEntire und Kollegen stehen kaum im Verdacht, schnellebigen Trends hinterherzuhecheln, ihr Universum aus Post-, Prog-, Kraut- und Jazzrock ist ohnehin uferlos genug, um jederzeit wieder einsteigen zu können.
Am Anfang von „The Catastrophist“ stand eine Auftragsarbeit der Stadt Chicago: Bands und Künstler sollten ihre Beziehung zu Chicago in Töne, Worte, Bilder fassen – vielleicht liegt es an meinem naiven Kunstverständnis, aber Auftragsarbeiten haben für mich immer einen faden Beigeschmack. Man muss halt was abliefern, im besten Fall für Geld. Tortoise fummelten jedenfalls ein paar Tracks zusammen, die sie auch live ausprobierten und daraufhin beschlossen, „ach, lasst uns doch ein ganzes Album draus machen, ist ja eh‘ mal wieder Zeit.“ Die elf neuen Stücke klingen wie eine „Tortoise-to-go“-Ausgabe: ein bisschen griffiger, leichter und kompakter, aber auch weniger vertrackt und ausschweifend als, sagen wir, „TNT“. Aber ok, das war ja auch 1998. Warum sollte man 2016 noch genauso klingen? Tortoise diggen auf interessant unspektakuläre Weise im eigenen Oevre, landen hin und wieder („Ox Duke“) bei verdaddeltem Jazz, streifen Referenzbands wie Can oder lassen auch mal ein Stück als abgewürgte Skizze im Raum stehen („Gopher Island“).
Zum ersten Mal in der Tortoise-Historie gibt es GastsängerInnen: Georgia Hubley von Yo La Tengo ist bei „Yonder Blue“ zu hören – Tortoise wünschten sich ursprünglich Robert Wyatt als Sänger, der absagte, weil er sich gerade zur Ruhe gesetzt hatte. Blieb Hubley als zweite Wahl, was zwar auf dem Stück gut zusammenpasst, aber atmosphärisch über dem ganzen Album hängt: Das ist alles nicht sooo toll. Erst recht nicht die Coverversion von David Essex‘ Siebzigerjahrehit „Rock on“, bei Tortoise gesungen/vokalisiert von Todd Rittman (sonst bei U.S. Maples, ebenfalls aus Chicago), die ungewohnt harsch durchs Bild trampelt. Es gibt einige große Momente auf „The Catastrophist“, die erahnen lassen, wie geil es ist, wenn Tortoise auf der Bühne impromäßig explodieren und trotzdem höchst kontrolliert dabei sind – aber bei einer Auftragsarbeit kann man‘ s ja auch mal eine Spur gewöhnlicher angehen lassen.
Christina Mohr
Den Last-Minute-Autor bestraft die Pünktlichkeit seiner Co-Autorin. Denn alles, was Christina hier bereits vorgelegt hat, könnte so ähnlich in meiner Besprechung gesagt werden – und muss es in Teilen auch trotzdem noch eimal. Denn eine Band wie Tortoise kann man 2016 nur aus ihrer historischen Position heraus verhandeln.
Als Tortoise in den frühen 90er Jahren plötzlich (via Thrill Jockey und City Slang) auftauchten, waren sie nicht weniger als eine Offenbarung, zeigten sie mit Songs wie “Gamera” und “Djed” und Alben wie “Tortoise”, “Millions Now Living Will Never Die” und “Rhythms, Resolutions & Clusters” doch einer Generation an Indie-Bands und -Hörern einen Möglichkeitsraum für ihre Welt nach dem “The Year Punk Broke” auf. Das was Slint noch viel kantiger und roher zu denken und umzusetzen gewagt hatten (und wofür sie erst mit den Jahren und nach der Auflösung so richtig geliebt wurden), durfte bei ihnen plötzlich auch harmonisch und verspielter fließen; da scheuten sich Musiker nicht mehr, ihr Können der eigenen Sturm-und-Drang-Sozialisation und Hardcore-/Indie-Community-Zugehörigkeit geschuldet zu unterdrücken. Und da war sie also plötzlich: Jazzmusik für Indiekids, die das Ohr auf den Schienen der Zeit hatte und sich ebenso auf Electroncia (und Zeitgenossen wie Pram, Mouse and Mars und den verfrickelten Aphex Twin) bezog wie auf Dub und natürlich die große weite Welt des Jazz zwischen Miles und Sun Ra. Es gab damals zum Debüt eine ganz tolle Besprechung von der Autorin Pinky Rose in der Zeit (die ich leider gerade nicht finde), die das Potential und die Bedeutung der Band früh sehr klar und weitsichtig erfasste. Die Konzerte jener frühen Tortoise Jahre waren von einer unvergleichlichen Energie, man spürte förmlich, dass da eine Gang an Musikern unterwegs war, deren Auftrag für sie selbst so mysteriös war, wie es die Schildkröte, die sie sich als Wappen ausgesucht hatten, so schön vermittelte.
Anyway. Damals war damals, und heute ist heute.
Was kann also nun „The Catastrophist“ dem Gesamtkunstwerk Tortoise noch hinzufügen? Der Start in das Album gelingt der Band zunächst gut. Das titelspendende Eröffnungsstück kommt auf derart verwirrende Art sofort unmittelbar in sich an, dass man als Autor gar nicht mehr groß reflektiert, sondern für den Moment einfach nur inmitten der Musik existiert. Was ja kein schlechter Ausgangsort ist, um sich ihr verstehend zu nähern.
Ja, es mag schon sein, dass diese Musik nicht mehr so die Welt revolutionierend klingt wie 1995 (der Fairness halber muss man ja auch die Frage aufwerfen, wie einem das als zwanzigjähriges Kontinuum auch gelingen könne?). Aber es fühlt sich auch nicht schlecht an mit ihnen mal wieder einen Raum zu teilen, ein bisschen wie bei einer Reunion von alten Freunden, die man lange nicht gesehen hat und derer Anwesenheit man sich sehr erfreut.
Was allerdings gar nicht geht, und da passt die Analogie zu einer solchen night out with the buddies, ist es, sich der Laune hinzugeben und spätnachts (zumal wir uns gerade Mal beim dritten Stück befinden) einen auf Klamauk zu machen. Denn nichts anderes ist “Rock On” in seiner akzentuierten Bierzelt-Rhythmik – man weiß auch sofort, warum Tortoise nun mal eine Instrumental-Band sind und ansonsten auf den Gesang verzichten. Unnötig. Ja, irgendwie würdelos. Da kann man danach auch nicht einfach wieder so auf blubbernde Elektronik und brummende Bläsern umschalten. Da wurde etwas nachhaltig zerbrochen für die kommenden Songs.
Auffällig ist generell, dass auf dem Album bis auf “Gesceap”, das die 7-Minuten-Grenzen sprengt, nur Songs von konventioneller Länge sind – in absoluter Negation des früher so intensiv ausgelebten Sprengpotentials in Raum und Zeit der Band. Wobei es ihnen auch auf “Gesceap” nicht gelingen will, offensichtlich zu machen, warum sie gerade hier nun auf Distanz gehen. Wo früher die Fähigkeit sich von der eigenen Musik hinreißen zu lassen Tortoise nachvollziehbar weit über die zehn Minuten Marke auf Alben und bei den Konzerten in Unendliche fliegen ließ, wirkt jetzt so ein singuläres Momentum wie eine aufgesetzte Geste. Ganz so als ob es nicht ohne ginge, aber auch jeden anderen Song hätte treffen können.
Gegegen Ende bekommen Tortoise und die Platte nochmals ein bisschen die Kurve. Das zweite Gesangsstück, jenes von Christina bereits erwähnte mit Georgia Hubley von Yo La Tengo, ist sehr schön. Hubley gelingt es, ihre Stimme als weitere Klangquelle in das Orchestra Tortoise einzufügen und eben nicht über dem Stück zu singen. Und auch die beiden finalen Songs, das sehr nach den 90er-Tortoise klingende “Tesseract” und “At Odds With Logic”, das gen Ende auf äußerst unprätentiöse Weise in sich zusammen bricht, stimmen versöhnlich.
Dennoch, Tortoise hätten eher eine EP aus den ersten zwei und den letzten drei Songs komprimieren sollen als unbedingt ein Album zu veröffentlichen (eines mit einem absolut grauenhaften Cover übrigens, siehe oben).
Tja, und dann steht da plötzlich “Djed” in seiner ganzen 21-minütigen Erhabenheit im Raum, Itunes sei Dank, und verbreitet eine Gänsehaut über meinem ganzen Körper.
Nostalgie sollte man zwar generell meiden, doch vermeiden lässt sie sich nicht immer.
Thomas Venker